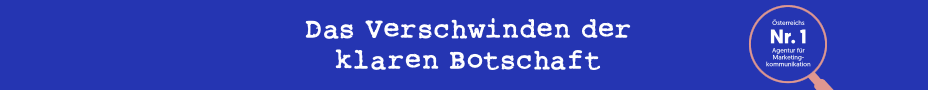Am 5. November jährte sich zum 70. Mal die Eröffnung der nach ihrer Zerstörung in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs wiederaufgebauten Wiener Staatsoper.
Das Haus am Ring beschäftigt sich aus diesem Anlass nicht nur mit den Themen Zerstörung, Wiederaufbau und Wiedereröffnung, sondern auch mit den historischen Ereignissen, die zur Zerstörung geführt haben, sowie mit der Rolle, die die Oper dabei gespielt hat.
Zerstörung und Wiederaufbau
Im Balkonumgang ist ab 5. November eine Ausstellung zu sehen, die den Besucherinnen und Besuchern der Wiener Staatsoper die Möglichkeit gibt, Aspekte des Wiederaufbau-Jahrzehnts in Fotos und ausgestellten Objekten zu erfahren.

Auch hier spannt sich die Erzählung von der Zerstörung des Hauses bis zur Wiedereröffnung, kurze Texte kontextualisieren das Gezeigte. Die Ausstellung ist bis Ende Jänner für alle Vorstellungsgäste vor den Aufführungen und in den Pausen frei zugänglich.
Staatsoperndirektor Bogdan Roščić betonte, im Rahmen des Festaktes im Schwindfoyer der Wiener Staatsoper, in seiner Ansprache:
„Es kennen viele von uns die unbelehrbare Hoffnung, dass die Kunst aus den damit beruflich beschäftigten Menschen doch bessere Menschen machen müsste. Wie falsch man damit liegen kann, hat leider auch die Geschichte der Staatsoper gezeigt. Heute ist eine umfassende Auseinandersetzung mit der Periode der Zerstörung und des Wiederaufbaus, mit dem Davor und Danach, nicht nur möglich, sondern selbstverständliche Pflicht. Und gerade auch deswegen ist der heutige Tag für uns hier am Haus so wichtig: Weil wir nicht nur unseren Geburtstag feiern, sondern auch einen Blick zurückwerfen wollen und diesen durch nichts einengen lassen wollen
„Im Palast der Selbsterfindung“
Anlässlich des 70. Jahrestags der Wiedereröffnung der Wiener Staatsoper erscheint im Molden Verlag ebenso das Buch „Im Palast der Selbsterfindung“, welches den Bogen von der Zerstörung der Oper bis zum Opernfest 1955 spannt.

Die Phase des Wiederaufbaus war nicht nur emotional, sondern auch politisch ein zentrales Thema der jungen Zweiten Republik und ihrer Suche nach einer neuen Identität. So stellte auch die Wiedereröffnung der Oper weit mehr dar als nur einen außergewöhnlichen Opernabend: Sie war der Inbegriff eines Neubeginns, mit all den Hoffnungen, Wünschen und leider auch Verdrängungen, Leugnungen und Beharrungen
Essays zu diesem Stück Zeitgeschichte in all seinen Facetten sowie eine Vielzahl bisher selten gezeigter Fotografien erzählen das Jahrzehnt des Wiederaufbaus im Spiegel der parallel dazu vollzogenen Brüche und Kontinuitäten neu. Der Bogen der Texte spannt sich von der erschreckenden Vorgeschichte ab 1938 über Fragen zur Identitätsgeschichte und zum „Mythos Staatsoper“ bis zur Architektur des wiedererbauten Hauses und unheilvollen Kontinuitäten in der Person von Künstlern wie Karl Böhm oder Rudolf Eisenmenger und zur Spielplanpolitik 1945 bis 1955.
Mit Beiträgen von Gerald Heidegger, Oliver Rathkolb, Anna Stuhlpfarrer, Sabine Plakolm-Forsthuber, Iris Frey, Andreas Láng und Oliver Láng sowie Susana Zapke.
Niemals vergessen!
Ganz genau 70 Jahre nach der Wiedereröffnung der Wiener Staatsoper präsentierte das Opernhaus eine Gedenktafel, die an jene Opfer des NS-Regimes erinnert, die am Haus tätig waren.

Die Tafel befindet sich rechts neben dem Haupteingang im Arkadengang der Oper. Über dem Schriftzug zeigt sie eine Arbeit von Käthe Kollwitz – »Die Klage«, entstanden in den Jahren 1938-41.
Danielle Spera zur Enthüllung der Gedenktafel:
„Heute – nur wenige Tage vor dem Jahrestag des Novemberpogroms – sind wir hier zusammengekommen, um jener Menschen zu gedenken, die mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten aus der Wiener Staatsoper vertrieben wurden. Unmittelbar nach dem sogenannten Anschluss begann die systematische Ausgrenzung und Verfolgung von jüdischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und politisch Unliebsamen. Es ist den Nationalsozialisten gelungen, diese Menschen auszulöschen. Wir sorgen dafür, dass die Erinnerung an sie lebendig bleibt. Gerade deshalb ist die Erinnerung so wichtig, daher bin ich für dieses Zeichen vor der Wiener Staatsoper, das so sichtbar ist und so gut in Erinnerung ruft, was hier passiert ist, dankbar.“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ergänzte in seiner Festrede:
„Die Kultur war auch ein Teil des Gründungsmythos der Zweiten Republik. Maßgeblich dabei der Tag der Wiedereröffnung der Staatsoper damals im Jahre 1955. Dass dieses Land seine Geschichte kennt und die richtigen Lehren aus ihr zieht, für all dies steht auch die Tafel, die heute enthüllt wird. Mein Dank gilt dieser Initiative der Wiener Staatsoper, namentlich Herrn Direktor Bogdan Roščić, dass es diese Gedenktafel jetzt gibt, dass sie gut sichtbar außen an der Ringstraße hängt und nicht irgendwo und ab heute zeigt, dass das Haus auch diesen Teil seiner Geschichte nicht vergisst. Gedenken wir der Opfer und arbeiten wir an einer guten Zukunft.“